Fiat, Citroën und Peugeot bauen ihre Transporter Ducato, Jumper und Boxer quasi am gleichen Band, wodurch 99% identisch sind, es gibt aber dennoch teilweise wichtige Unterschiede, insbesondere bei den Motoren.
subjektive Empfehlung kurz und knapp
Typ 280/290 (’82-’94): viel zu alt
Typ 230 (’94-’02): zu alt
Typ 244 (’02-’06): interessant, wenn guter Zustand und kräftiger Motor
Typ 250/X250 (’06-’14): gut, aber ein paar Kinderkrankheiten
Typ 250/X290 (’14-…): sehr gut, aber schon sehr viel Elektronik
Das Joint-Venture der drei Autobauer nennt sich Sevel („Società Europea Veicoli Leggeri / Société Européenne de Véhicules Légers“), daher finden sich im Internet häufig Modellbezeichnungen wie „Sevel 250“, um nicht unnötig unterscheiden zu müssen, welches Modell man meint, wenn es eh keinen Unterschied zwischen den drei Modellen gibt (bzw. ab 2021 vier Modelle, da der Opel Movano C nun auch ein Sevel ist).
Der Wohnmobilmarkt wird quasi von Sevel-Modellen regiert in der Kategorie bis 3,5t und im Transportersegment haben sie ebenfalls enorme Marktanteile. Egal, wie viel manche über Fiat und Konsorten schimpfen, die Sevel-Modelle sind erprobt und robust, wenngleich jede Baureihe ihre Stärken und Schwächen hat. Besonders macht sie allerdings, dass die Karosserie sehr breit und bauchig ist, sodass sich problemlos ein 2m-Querbett einbauen lässt (alle anderen Basisfahrzeuge sind deutlich schmaler und bieten ohne teuren Umbau maximal 1,90m in der Breite) und man hat schon vor einigen Jahrzehnten den Hebel der Handbremse auf die linke Seite des Fahrersitzes gebaut, um Drehsitze zu ermöglichen. Frontantrieb, niedrige Ladekante, kurze und übersichtliche Motorhaube sowie sinnvolle Fahrzeuglängen (z. B. 6,4m, die perfekt für Längsbetten sind) machen den Sevel geradezu zur maßgeschneiderten Wohnmobilbasis, sofern man keine allzu großen Abenteuer plant, denn die erfordern gerne Heck- oder Allradantrieb und gehören eher dem Transit, Sprinter oder Daily.
Ducato: primus inter pares
Auch wenn sich alle Sevel das Fahrwerk, die Karosserie und auch sonst das meiste teilen, gibt es einen erstaunlich blöden Grund, warum der etwas teurere Ducato besser ist als seine Geschwister: Fahrzeugteile brauchen je nach Verwendungszweck spezielle Prüfgutachten, welche modellspezifisch und schweineteuer sind. Das hat zur Folge, dass spezielle Bauteile (meistens geht es um (Luft)Federn oder Stoßdämpfer, gilt im Grunde aber für vieles mehr) zwar problemlos in alle Sevel eingebaut werden können, da die Befestigungen und Anforderungen identisch sind, wenn sie aber für eine technische Änderung vom TÜV herangezogen werden (oftmals für eine Auflastung), sind Prüfgutachten nötig, die explizit für das eigene Fahrzeugmodell erstellt worden sein müssen. Da der Ducato mit Abstand öfter verkauft wird als Jumper, Boxer oder Movano, gibt es die Gutachten häufig nur für den Ducato und somit werden Abnahmen vom TÜV für eigentlich baugleiche Geschwister-Fahrzeuge abgelehnt.
Meistens betrifft das Thema eine Auflastung, im dümmsten Fall aber jeden TÜV-relevanten Umbau von Fahrwerk, Licht oder was auch immer.
Auch nicht ganz zu vernachlässigen: Im Ducato werden viele Iveco-Motoren verbaut, die eine sehr gute Reputation haben, während Jumper und Boxer lange Motoren von PSA/Ford mit eher neutralem bis schlechtem Ruf verbaut haben (sogenannte „Puma“-Motoren). Ein gutes Automatikgetriebe (ab 2020/Multijet2-Motoren) sowie eine größere Auswahl an Assistenten und technischen Spielereien bietet nur Fiat bzw. ist meistens Vorreiter – jedoch nicht zu vergleichen mit den Extravaganzen im Sprinter. Ebenfalls für den Ducato spricht ein gutes Netz an Fiat Professional-Werkstätten, die u. a. auf den Ducato spezialisiert sind (Citroën- und Peugeot-Werkstätten haben teilweise wenig Erfahrung mit den kommerziellen Fahrzeugmodellen Jumper/Boxer).
Fahrwerk: Light oder Maxi/Heavy?

Die folgenden Angaben gelten vor allem für den Typ 250/X250/X290 ab 2006. Der Sevel ist mit zwei Fahrwerken erhältlich: Light bis maximal 3,5t und Maxi bis maximal 4,25t. Teilweise sind diese abgelastet (Light auf 3,3t und Maxi auf 3,8t), eine Auflastung auf den Originalzustand ist häufig ohne Umbau oder TÜV-Abnahme einfach bei der Zulassungsstelle möglich, das muss aber immer in Einzelfall geprüft werden.
Etwas genauer hinschauen sollte man bei den Bezeichnungen: Ein Light 30-Modell ist auf 3,0t ausgelegt und kann nicht unbedingt aufgelastet werden, ein Light 33 (3,3t) jedoch ist technisch identisch mit einem Light 35 (3,5t) und damit problemlos auflastbar. Genauso verhält es sich beim Maxi: Der Maxi 35 (3,5t) ist nicht unbedingt zum Auflasten geeignet, erst die Modelle Maxi 40 (4,0t) und Maxi 42,5 (4,25t) sind vorne wie hinten mit großen Bremsen etc. ausgestattet für dauerhaft mehr als 3,5t Gewicht. Leider gibt es auch noch einmal Unterschiede je nach Motor und vor allem zwischen den Modellen mit manuellem und Automatikgetriebe – es lohnt vorher ein prüfender Blick in die technischen Datenblätter.
Die Unterschiede zwischen den Fahrwerken liegen bei:
- Bremsen: der Light hat unterdimensionierte Bremsen, die des Maxi sind dem Gewicht eher gewachsen (außer Maxi 35, der hat große Bremsen vorne und noch kleine Bremsen hinten; große Bremsen hinten erst ab Maxi 40),
- Bremskraftverstärker: deutlich größerer Tandem-Bremskraftverstärker beim Maxi 40 und 42,5,
- Federn: an der Vorder- und Hinterachse verfügt der Maxi über verstärkte Federn, das Light-Fahrwerk liegt bei 3,5t häufig auf den Gummipuffern auf, da die Federn überlastet sind,
- Stoßdämpfer: die vorderen Stoßdämpfer sind beim Maxi deutlich verstärkt, die hinteren ein wenig,
- Radnabe/Felgen: alle Light-Modelle haben standardmäßig 15″-Felgen (Lochkreis 5×118), beim Maxi sind 16″ Standard mit größerem Lochkreis (5×130) und daher ist auch die Radnabe größer (16″-Räder sind beim Light ab X290/2014 ab Werk möglich gegen Aufpreis, jedoch mit kleinem Lochkreis und kleinen Bremsen).
Unterm Strich ist das Light-Fahrwerk bis maximal 3,0t gut einsetzbar, 3,5t sollten eine kurzfristige Ausnahme sein. Bei Transportern entspricht das vielen Anwendungsszenarien, während Wohnmobile selbst leer meist über 3t wiegen und voll beladen üblicherweise 3,5t und mehr. Dementsprechend sind die Bremsen, Federn und Stoßdämpfer beim Light ständig überbeansprucht, was Sicherheit, Komfort und Verschleiß negativ beeinflusst (Schlaglöcher, lange Bergabfahrten oder Gefahrenbremsungen sind dann ein echtes Problem). Federn und Stoßdämpfer lassen sich problemlos und günstig tauschen, größere Bremsen vom Maxi können ebenfalls verbaut werden, wenn man gleichzeitig alles drumherum tauscht (Radnabe, (Bremskraftverstärker), Bremssättel, Felgen, Reifen) – dann lieber direkt einen Maxi 40 kaufen. Die größeren 16″-Felgen des Maxi haben darüber hinaus den Vorteil, dass größere Reifen ohne Tachoangleichung und TÜV-Abnahme aufgezogen werden können, wodurch Bodenfreiheit und Fahrstabilität steigen. (Es gibt auch für den kleineren Lochkreis beim Light 16″-Felgen, z. B. von Ramto, diese kosten aber entsprechend viel und eine Tachoangleichung kann bei großen Reifen wie 225/75 R16 nötig sein, während diese beim Maxi Standard sind.)
Unterm Strich ist das Maxi-Fahrwerk immer zu bevorzugen, das Mehrgewicht des Maxi lohnt sich defintiv. Maxi 40 oder notfalls Maxi 35; Light 33/35 nur für kleine, leichte Wohnmobile, die deutlich unter 3,5t bleiben.
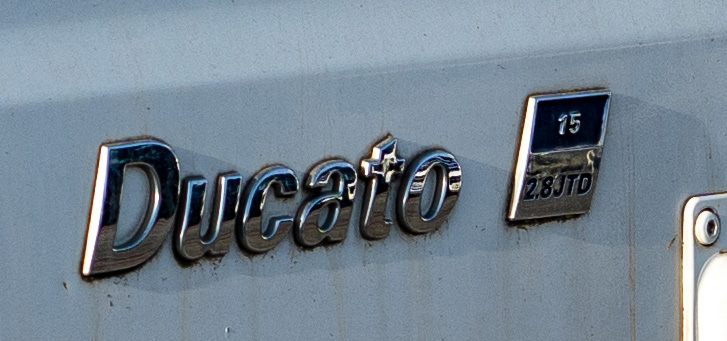
Fahrwerksbezeichnungen: Sevel verwendet unterschiedliche Bezeichnungen bei den Fahrwerken, die sehr verwirrend sein können. Insbesondere bei der Suche nach neuen Fahrwerksteilen ist manchmal nur von bspw. „Q18“ die Rede statt exakter Fahrzeugbezeichnungen.
244:
Typ 11/Q11/30 – 2,9t mit Light-Fahrwerk
Typ 13/Q13/33 – 3,3t Light
Typ 15/Q15/35 – 3,5t Light
Typ 18/Q18/Maxi – 3,5t Maxi
250:
Typ 11/Q11/30 – 3,0t Light
Typ 12/Q12/30 – 3,0t Light
Typ 13/Q13/33 – 3,3t Light
Typ 15/Q15/33 – 3,3t Light
Typ Q17L/35 Light – 3,5t Light
Typ Q17H/35 Maxi – 3,5t Maxi
Typ Q20/40 Maxi – 4,0t Maxi
Typ Q20/42,5 Maxi – 4,25t Maxi
1994-2002: Typ 230 (Ducato II, Jumper/Boxer I)





Der Typ 230 ist inzwischen quasi nur noch als teilintegriertes Wohnmobil zu finden, da alle Transporter ihre Lebenserwartung überschritten haben (im Verhältnis dazu wenig gefahrene und gut gepflegte Teilintegrierte gibt es noch als Beinahe-Oldtimer). Auf der Suche nach einem Kastenwagen als Basis ist der Nachfolger bzw. das Facelift Typ 244 besser geeignet. Der Vorgänger heißt Typ 280/290 und ist nicht mit dem X290 (seit 2014) zu verwechseln. Aufgrund des Alters ist Euro 3 üblich, ein Dieselpartikelfilter und damit Euro 4 ist ggf. möglich, kostet aber viel zu viel.
Stärken
Für sein Alter und in Kombination mit dem 2,8-Liter-Motor ein sehr zuverlässiges Fahrzeug, die meisten Probleme sind jetzt altersbedingt.
Schwächen

Insbesondere der Vorgänger Typ 290 ist berüchtigt für Getriebeprobleme am 5. Gang, die es – aus anderen Gründen – beim 230er auch gibt. Sollte sich der 5. Gang schlecht einlegen lassen oder der Schaltknüppel Bewegungen/Spiel im 5. Gang zeigen, Finger weg!
Ansonsten leidet der 230er sehr an Rostproblemen unten rum. Und die Leuchtweitenregulierung fällt beim TÜV häufiger negativ auf.
Bester Motor
Ab 1998 gab es für alle Sevel den 2,8-Liter-Motor i.d. TD (122 PS, 285 Nm, Motorcode 8140.43) und ab 2000 den baugleichen 2.8 JTD/2.8 HDi (128 PS, 300 Nm, Motorcode 8140.43S) mit moderner Common-Rail-Einspritzung. Beide Motoren von Iveco kamen in zahlreichen weiteren Fahrzeugen zum Einsatz und gelten als sehr langlebig und wartungsarm, nur der Zahnriemen muss regelmäßig getauscht werden und den Getriebeölstand muss man beachten, damit es nicht zu Problemen mit dem 5. Gang kommt.
Wichtige Links und Quellen
Zeichnungen und Teilenummern (Alternative) – Links-/Rechtslenker darf nicht ausgewählt werden
2002-2006: Typ 244






Der 244er als Facelift/Weiterentwicklung des 230 genießt einen sehr guten Ruf: Die Probleme des 230 wurden behoben, es gibt zwei ausgezeichnete Motoren, die Wartungsanfälligkeit ist sehr gering und durch viel Mechanik und wenig Elektronik lässt sich vieles einfach reparieren. Fahrer-Airbag und ABS sind Serie, die grüne Plakette (Euro 4) kann durch einen nachrüstbaren Dieselpartikelfilter zu einem akzeptablen Preis erreicht werden. Als Kastenwagen gibt es maximal 5,6m Länge, sodass 3,3 bis 3,5t gut machbar sind, was beim Nachfolger Typ 250 mit häufig 6m Länge schon schwieriger wird.
Besonders markant am 244er-Kastenwagen ist die sehr breite B-Säule zwischen Fahrerhaus und Schiebetür, wodurch sich andere Grundrisse als bei quasi allen anderen Fahrzeugen ergeben. Dort findet bspw. hinter dem Beifahrersitz ein hoher Schrank oder häufig der Kühlschrank Platz.
Das Maxi-Fahrwerk mit größeren 16″-Reifen (mehr Bodenfreiheit), deutlich größeren Bremsen und insgesamt verstärkten Fahrwerkskomponenten bietet deutlich mehr Fahrstabilität und Sicherheit und ist daher als Wohnmobil – wie bei allen anderen Sevel auch – dem Light-Chassis vorzuziehen. Es empfehlen sich das schwächere 3,3t-Light-Fahrwerk Typ 15 (auflastbar mit neuen Federn vorne und hinten auf bis zu 3,75t) oder das stärkere 3,5t-Maxi-Fahrwerk Typ 18 (auflastbar mit stärkeren Federn hinten auf 4,0t).
Längen, Höhen, Radstände
Die verfügbare Längen, Höhen und Radstände im Überblick und ihre Kombinationen.
- L1-L3: 4.750mm, 5.100mm, 5.600mm
- H1-H3: 2.150mm, 2.470mm, 2.725-2.860mm
- R1-R3: 2.850mm, 3.200mm, 3.700mm
| H1 | H2 | H3 | |
| L1 | R1 | R1 | |
| L2 | R2 | R2 | R2 |
| L3 | R3 | R3 |
Stärken
Die Karosserie ist gut gegen Rost geschützt, allzu viel Elektronik gibt es noch nicht (weniger kann kaputt gehen, dafür fehlt so manche Annehmlichkeit neuerer Fahrzeuge), insgesamt sehr robust und langlebig.
Schwächen
Das Getriebe zu den beiden empfehlenswerten Motoren gibt es mit einem kurz und einem lang übersetzten 5. Gang. Die kurze Übersetzung erlaubt bei niedriger Geschwindigkeit den Wechsel vom 4. in den 5. Gang und ergibt bei Tempo 80 eine laufruhige und sparsame Motordrehzahl und auch Steigungen lassen sich bequem fahren, bei Tempo 100 jedoch steigen Drehzahl, Verbrauch und Lärm. Der lange 5. Gang ist ideal auf der Autobahn, lässt sich aber erst bei höherer Geschwindigkeit einlegen, sodass man auf der Landstraße viel im 4. Gang bei hoher Drehzahl fährt oder oft zwischen 4. und 5. Gang hin- und herschalten muss. Fahrzeuggewicht, Luftwiderstand/cw-Wert (besonders hoch bei Teilintegrierten mit Alkoven) und Motorleistung spielen ebenfalls rein: Ein schweres, großes Fahrzeug mit schwachem Motor und langem 5. Gang ist keine gute Kombination. Ein kleiner, leichter Kastenwagen mit starkem Motor hingegen harmoniert gut mit dem langen 5. Gang.
Bester Motor
Der Iveco-Motor 2.8 JTD/2.8 HDi (128 PS, 300 Nm, Motorcode 8140.43S) mit Zahnriemen hat einen exzellenten Ruf. Er ist eine Weiterentwicklung des 2.8 i.d. TD aus dem Typ 230 und bekam ab 2004 mehr Leistung durch einen neuen Turbolader (2.8 JTD POWER/2.8 HDi POWER mit 146 PS, 310 Nm, Motorcode 8140.43N). Die Leistung lässt sich weiter steigern, indem man den Common-Rail-Drucksensor des moderneren 2.3 JTD einbaut.
Der neuere/modernere 2.3 JTD (110 PS, 270 Nm, Motorcode F1AE0481C) ist nur für den Ducato erhältlich und für Kastenwägen ideal, während der größere 2.8-Liter-Motor in Teilintegrierten oder schweren Fahrzeugen mit Maxi-Fahrwerk gewählt werden sollte.
Wichtige Links und Quellen
Zeichnungen und Teilenummern (Alternative) – Links-/Rechtslenker darf nicht ausgewählt werden
2006-2014: Typ 250 („X250“, Ducato III, Jumper/Boxer II)





Alle Sevel seit 2006 gehören dem Typ 250 an, es gab jedoch 2014 und 2021 umfassende Veränderungen, die als neue Modellgeneration bezeichnet werden können, auch wenn der Name gleich bleibt. Häufig wird der erste 250er von 2006 bis 2014 als X250 bezeichnet und der zweite 250er als X290, der dritte 250er wird aufgrund der großen Ähnlichkeit zum X290 meist auch so genannt. Nicht verwechseln darf man den Typ 290 von Anfang der 90er (Vorgänger des Typ 230) mit dem X290.
Während die älteren Modelle wirklich nicht mehr modern aussehen, hat der 250er bis 2014 ein knuffiges, rundliches Aussehen und ab 2014 ist er kantiger, aggressiver und sehr zeitgemäß. Ausgestattet ist er mit allen notwendigen Basics wie ABS und Fahrerairbag, es gibt aber keine großartigen Spielereien. Im Gegensatz zu den Vorgängern, fühlt sich der 250er wie ein größerer Pkw an: übersichtlich, angenehm zu fahren und leise. Das Fahrerhaus ist, wie bei Nutzfahrzeugen üblich, einfach gehalten, es fehlen aber Ablagen – es gibt nicht mal einen Becherhalter (nicht einen auf der Fahrerseite!). Zum Glück gibt es solche Halter für die Lüftungsschlitze oder teure Nachrüst-Sets, die aber dafür das Fach in der Mitte oder das Handschuhfach opfern.
2011 wurden alle Motoren modernisiert: Euro 5 statt Euro 4, etwas mehr Leistung und gleichzeitig spritsparender.
Längen, Höhen, Radstände
Die verfügbare Längen, Höhen und Radstände im Überblick und ihre Kombinationen. (Beim Ducato gibt es in Deutschland keine Länge L3, daher entspricht L4 beim Ducato L3 bei Jumper/Boxer.)
- L1-L5: 4.960mm, 5.410mm, (L3 gibt es beim Ducato nicht), 5.998mm, 6.360mm
- H1-H3: 2.254mm, 2.520mm, 2.764mm
- R1-R3: 3.000mm, 3.450mm, 4.035mm
| H1 | H2 | H3 | |
| L1 | R1 | ||
| L2 | R2 | R2 | |
| L3 | |||
| L4 | R3 | R3 | |
| L5 | R3 | R3 |
Stärken
Der X250 hat ein Mindestmaß an Sicherheitssystemen (ABS, ESP, Fahrerairbag) und bereits einiges an Elektronik verbaut, im Grunde ist das meiste aber reine Mechanik und damit einfach zu reparieren. Da das Modell schon etwas älter ist, sollten die Kinderkrankheiten ausgemerzt sein (entweder repariert oder die Fahrzeuge sind nicht mehr unterwegs), andernfalls sind sie relativ gut zu identifizieren. An und für sich ein sehr solides Fahrzeug und eine tolle Basis, das in Europa sehr verbreitet ist, wodurch Ersatzteile leicht zu beschaffen sind.
Schwächen
Manche Schwächen wie schlechte Radlager sollten inzwischen in jedem betroffenen Fahrzeug ausgemerzt sein, andere wie Wassereintritt in den Motorraum wurden erst im Facelift 2014 beseitigt (Wasser kann sich durch ein ungeeignetes Ablaufsystem von der Windschutzscheibe in den Motorraum ergießen und dadurch allerhand Schaden anrichten, am bekanntesten sind festgerostete Glühkerzen, die schlimmstenfalls beim Tausch abbrechen und einen Tausch des Zylinderkopfes notwendig machen – zum Glück kann man das Ablaufsystem selber optimieren).
Wie auch beim Typ 230 gibt es teilweise Getriebeprobleme, hier beim 6. Gang und insbesondere mit den 3-Liter-Motoren, die zu kräftig fürs Getriebe sind. Sollte sich der Schalthebel im 6. Gang bei Lastwechseln (Gas geben und wegnehmen) bewegen oder vibrieren, droht ein teurer Getriebeschaden (Finger weg von dem Fahrzeug!). Vorbeugend hilft, alle 100.000km das Getriebeöl zu wechseln und dieses immer am Max-Füllstand zu halten.

Eine sehr viel bekanntere Schwäche sind Lackierfehler, bei denen der Lack einfach abblättert. An sehr vielen Sevel sieht man dies, helfen tut nur eine neue Lackierung oder Folierung. Zum Glück ist die Grundierung der Karosserie so gut, dass selbst mehrere Jahre alte Lackschäden häufig nicht rosten, daher ist dies erst einmal ein kosmetisches Problem.
Eine leicht zu behebende Schwäche ist der Unterfahrschutz: Dieser ist dreiteilig, ab Werk ist meist aber nur ein Element verbaut, da die anderen beiden Aufpreis kosten. Der unvollständige Unterfahrschutz lässt die Ölwanne und Riemen ungeschützt, sodass diese von Steinchen etc. beschädigt werden können, daher unbedingt komplettieren oder einen neuen, dreiteiligen montieren.



Bester Motor
Bis 2011: Der 3,0-Liter Multijet 160 bzw. HDi 160 (160 PS, 400Nm, Motorcode F1CE0481D) ist der stärkste Motor, der zur Auswahl stand, und mit Steuerkette statt Zahnriemen ausgestattet. Somit entfällt der Zahnriemenwechsel und die Gefahr, dass dieser reißen könnte.
Die Steuerkette ist wartungsfrei ausgelegt und sollte ein Motorleben lang halten - wird jedoch ein Tausch nötig, muss aus Platzgründen der komplette Motor raus, wodurch die Kosten enorm steigen (alle Sevel-Motoren ab 2016 sind nur noch mit Zahnriemen erhältlich, dieser sollte jedoch tunlichst nach Handbuchvorgaben gewechselt werden, um Motorschäden vorzubeugen; beim Gebrauchtkauf auf Rechnungen/Nachweise zum letzten Zahnriemenwechsel bestehen).Der starke Iveco-Motor macht auch bei höherem Gewicht Spaß zu fahren und ist sehr robust, jedoch auch sehr groß: Beim Ölwechsel sind unglaubliche 9l nötig und er hängt samt Ölwanne tiefer als die kleineren Motoren, sprich: unbedingt vollständigen Unterfahrschutz verbauen, um die Ölwanne zu schützen (wenn die durch regelmäßige Steinschläge irgendwann leckschlägt, hat man einen Motorschaden). Durch die hohe Leistung liegt der Verbrauch jedoch etwas höher als bei den kleineren Modellen.
Der 2,3-Liter Multijet 130 (130 PS, 320 Nm, Motorcode F1AE0481N, nur für Ducato erhältlich) besitzt ebenfalls eine Steuerkette und ist bis 3,5t zu empfehlen.

Ab 2011: Alle Motoren haben eine Leistungssteigerung und Verbrauchsreduzierung spendiert bekommen und zusätzlich jetzt Euro 5 statt Euro 4 (komplett ohne AdBlue). Der 3,0-Liter-Motor heißt jetzt Multijet 180 bzw. HDi 180 bzw. 3.0 HDi und leistet 180 PS und 400 Nm, der Motorcode lautet F1CE3481E. Der kleinere 2,3-Liter-Motor für den Ducato heißt nun Multijet 150 (150 PS, 350 Nm, Motorcode F1AE3481E) und bietet ausreichend Leistung für alle Kastenwagen, während der 3,0-Liter-Motor für sehr große Teil-/Vollintegrierte oder Gespanne mit schweren Anhängern ideal ist.
Für Jumper und Boxer gibt es einen 2,2-Liter-Motor, der jedoch nicht zu empfehlen ist.
Wichtige Links und Quellen
- Zeichnungen und Teilenummern 2006-2011 – die Fahrzeugauswahl ist leider alles andere als benutzerfreundlich
- Zeichnungen und Teilenummern 2011-2014
- Liste mit den wichtigsten Anzugsdrehmomenten und Schraubenmaßen (ducatoforum.de)
- Software „eLearn“ mit Reparaturanweisungen/Werkstatthandbuch und mehr (im fiatforum.com – Downloadbereich suchen)
- Handbuchauszug mit technischen Daten (Download)
Facelift 2014 („X290“)






Das große Facelift von 2014 bestimmt noch immer die schärfere, aggressivere Optik der Sevel-Modelle bis heute. An der Karosserie hat sich nicht viel getan, Assistenzsysteme und Technik wurden dafür aktualisiert und das Fahrwerk verbessert. 16″-Reifen sind jetzt gegen Aufpreis auch beim Light-Fahrwerk ab Werk möglich, allerdings mit dem kleinen Lochkreis 5×118 und der kleinen Bremsanlage.

Ab 2015 steht ein Allrad-Umbau der Firma Dangel zur Verfügung, der allerdings nicht gegen den Werksallrad von Sprinter oder Daily anstinken kann. Motoren mit Euro 6 (ohne AdBlue) und später Euro 6d-temp (mit AdBlue) wurden nach und nach von Fiat eingeführt, Citroën und Peugeot verbauten ab Euro 6 bereits Motoren mit AdBlue-SCR-Katalysator. Insgesamt ist der X290 die gute Weiterentwicklung eines bereits bewährten Vorgängers. Durch mehr Technik und komplexere Motoren (insbesondere die aufwändige Abgasreinigung ab Euro 6) kann natürlich mehr kaputt gehen und für immer mehr Reparaturen ist ein Diagnosegerät nötig.
Erwähnen sollte man noch, dass die Euro 5- und Euro 6-Ducatos vom Dieselskandal betroffen sind, Schadenersatzforderungen oder dergleichen wurden aber von den meisten Gerichten abgelehnt und Fahrverbote/Stilllegungen drohen auch nicht.
Längen, Höhen, Radstände
Die verfügbare Längen, Höhen und Radstände im Überblick und ihre Kombinationen. (Beim Ducato gibt es in Deutschland keine Länge L3, daher entspricht L4 beim Ducato L3 bei Jumper/Boxer.)
- L1-L5: 4.960mm, 5.410mm, (L3 gibt es beim Ducato nicht), 5.998mm, 6.360mm
- H1-H3: 2.254mm, 2.520mm, 2.774mm
- R1-R3: 3.000mm, 3.450mm, 4.035mm
| H1 | H2 | H3 | |
| L1 | R1 | R1 | |
| L2 | R2 | R2 | |
| L3 | |||
| L4 | R3 | R3 | |
| L5 | R3 | R3 |
Stärken
Problemchen des X250 wurden behoben und alles bloß verbessert und modernisiert. Da es keine großen Sprünge gab, sind kaum neue Fehler aufgetaucht und die Zuverlässigkeit ist verbessert worden. Lackprobleme treten kaum noch auf (wenn, dann meist an lackierten Dichtfugen/Nähten). Zudem ist das Design außen und im Fahrerhaus aufgehübscht worden.
Schwächen
Das Mehr an Elektronik kann etwas schwerer einzugrenzende Fehler bereiten, insbesondere die Masse-Verbindungen (Starterbatterie, Motoraufhängung) können Probleme machen, ggf. auch Plus-Anschlüsse an Lichtmaschine und Anlasser. Fehlerhafte Sensoren treten bei den neuesten Modellen des 2014er-Facelift und dem 2021er-Nachfolger öfter auf, werden aber meist auf Gewährleistung getauscht. Ein funktionierender Regenwasserablauf am Übergang Windschutzscheibe zur Motorhaube sollte kontrolliert werden, damit der Motorraum nicht regelmäßig unter Wasser steht, hier wurde scheinbar mehrfach optimiert. Ein vollständiger Unterfahrschutz ist wie beim X250 wichtig und leider nicht serienmäßig ab Werk montiert.
Die wenigen und unpraktischen Ablagemöglichkeiten im Fahrerhaus des Vorgängers wurden leider nicht verbessert.
Bester Motor
Fiat Euro 6 (ab 2016): Multijet 130, 150 und 180 sind quasi identische 2,3-Liter-Motoren von Iveco (alle ohne Steuerkette), die in Details verändert wurden. Der Multijet 180 (180 PS, 400 Nm, Motorcode F1AGL411B) entspricht dem 3,0-Liter-Vorgänger von der Leistung her und ist für sehr große, schwere Fahrzeuge/Gespanne mit Anhänger ideal. Bis etwa 3,5t ist der sportliche Multijet 150 (150 PS, 380 Nm, Motorcode F1AGL411C) eine tolle Wahl, der schwächere Multijet 130 (130 PS, 320 Nm, Motorcode ?) aber auch in Ordnung.
Fiat Euro 6d-temp (ab 2020): Wieder basieren alle Modelle auf ein- und derselben Basis, einem 2,3-Liter-Iveco-Motor, nun ist aber ein SCR-Katalysator mit AdBlue verbaut. Technisch nehmen sie sich nicht viel, entscheidend ist die gewünschte Sportlichkeit des Motors: der 140 Multijet2 (140 PS, 350 Nm, Motorcode F1AGL4113) oder 160 Multijet2 (160 PS, 380 Nm, Motorcode F1AGL4112) sind das ideale Mittelfeld. (Bisherige Automatikgetriebe waren solala, ab diesen Motoren gibt es eine gute 9-Gang-Automatik vom Hersteller ZF. Mit dem Automatikgetriebe haben die 160/180 Multijet2-Motoren sogar mehr Drehmoment!)
Citroën/Peugeot Euro 6 (ab 2016): Im Gegensatz zu den schlechten Vorgängermotoren scheinen die 2,0-Liter-Motoren BlueHDi 110, 130 und 160 sehr viel unproblematischer zu sein. Schwächen sind keine bekannt.
Citroën/Peugeot Euro 6d-temp (ab 2019): Zu den 2,2-Liter-Motoren gibt es keine bekannten Probleme, da sie noch sehr neu sind.
Wichtige Links und Quellen
- Zeichnungen und Teilenummern ab 2014 – die Fahrzeugauswahl ist leider alles andere als benutzerfreundlich
Facelift 2021






Das Facelift 2021 bringt vor allem LED-Scheinwerfer, elektrische Handbremse (kein Handbremshebel mehr, der mit Drehsitzen kollidieren könnte), mehr Technik, modernere Assistenzsysteme, ein ansprechenderes Fahrerhaus und Motoren mit Euro 6d-final statt bisher Euro 6d-temp. Zusätzlich gibt es ab jetzt den Opel Movano C als Sevel-Modell (vorher baugleich mit Renault Master und stark verwandt mit Nissan Interstar). An Karosserie, Abmessungen und Fahrwerk hat sich nichts groß getan, die Anhängelast steigt jedoch auf 2,5t.
Längen, Höhen, Radstände
Die verfügbare Längen, Höhen und Radstände im Überblick und ihre Kombinationen. (Beim Ducato gibt es in Deutschland keine Länge L3, daher entspricht L4 beim Ducato dem L3 bei Jumper/Boxer/Movano.)
- L1-L5: 4.960mm, 5.410mm, (L3 gibt es beim Ducato nicht), 5.998mm, 6.360mm
- H1-H3: 2.254mm, 2.520mm, 2.774mm
- R1-R3: 3.000mm, 3.450mm, 4.035mm
| H1 | H2 | H3 | |
| L1 | R1 | R1 | |
| L2 | R2 | R2 | |
| L3 | |||
| L4 | R3 | R3 | |
| L5 | R3 | R3 |
Stärken
Der X290 von 2014 war schon solide, die Weiterentwicklung macht keine großen Sprünge und damit auch nichts falsch. Ob man das große Mehr an Elektronik und Technik-Klimmbimm gut findet, muss man für sich entscheiden.
Schwächen
Bisher keine bekannt. (Jumper, Boxer und Movano hängen mit modernsten Assistenzsystemen etwas hinterher, der Ducato ist hier derzeit immer etwas früher dran.)
Bester Motor
Die bisherigen 2,3-Liter-Multijet2-Motoren wurden weiterentwickelt zum 2,2-Liter-Multijet3: 120 Multijet3 (120 PS, 320 Nm, Motorcode 46349131), 140 Multijet3 (140 PS, 340 Nm, Motorcode 46349131) und den beiden besonders für sehr große und schwere Fahrzeuge geeigneten 160 Multijet3 (160 PS, 380 Nm, Motorcode 46348913) und 180 Multijet3 (180 PS, 380 Nm, Motorcode 46348913). Für den 140/160/180 Multijet3 gibt es eine gute 9-Gang-Automatik, die noch mehr Drehmoment bietet.
Citroën und Peugeot haben ihre 2,2-Liter-Motoren BlueHDi 120/140/165 ebenfalls auf Euro 6d geupdated. Der Movano C kommt ebenfalls mit diesen.
Wichtige Links und Quellen
- Zeichnungen und Teilenummern ab 2014 – die Fahrzeugauswahl ist leider alles andere als benutzerfreundlich
